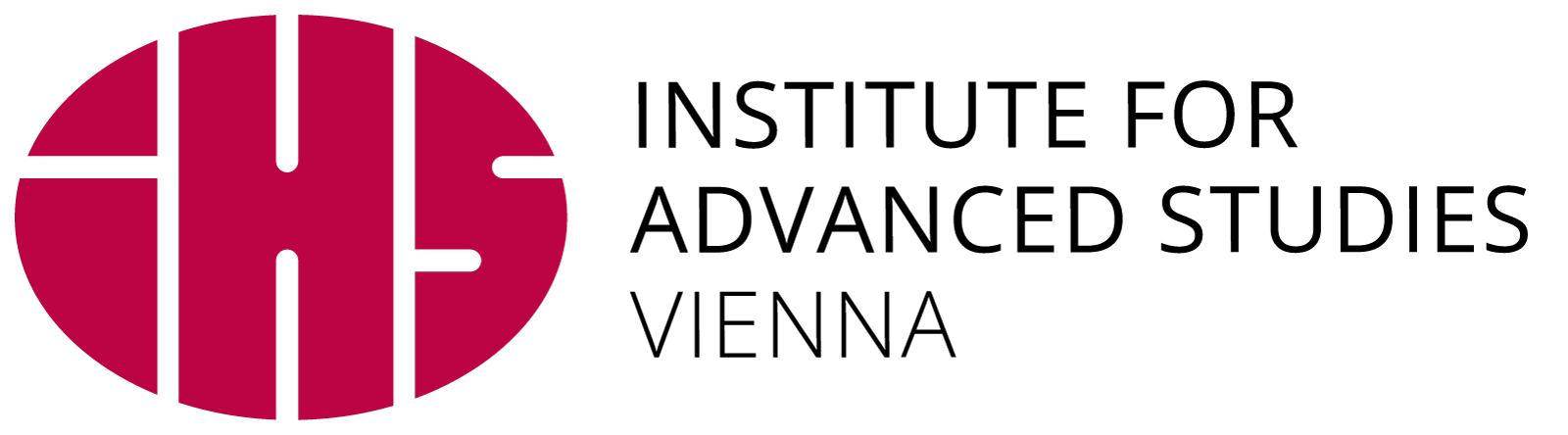Spotlight: Stefan Vogtenhuber

Stefan Vogtenhuber ist Bildungssoziologe und Teil der Forschungsgruppe in_Equality and Education. Er befasst sich mit Bildungsprozessen sowie den Ergebnissen von Bildung.
Du befasst dich am IHS mit dem Thema Bildung, welche Aspekte beschäftigen eure Forschungsgruppe besonders?
Wir beschäftigen uns mit Vorgängen und Prozessen im Bildungswesen an sich und darüber hinaus mit den Ergebnissen von Bildungsprozessen und deren Auswirkungen – etwa auf dem Arbeitsmarkt. Wir interessieren uns aber zunehmend auch für den Zusammenhang von Bildung mit vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, etwa mit politischer Beteiligung, Vertrauen in Institutionen bzw. soziales Vertrauen und gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Gesundheitsunterschieden in der Bevölkerung. Ein wichtiger Aspekt unserer Analysen ist die Frage bestehender sozialer Ungleichheiten und wie sich diese im Zeitverlauf entwickeln.
Lässt sich der Zusammenhang dieser Themen mit Bildung belegen?
Es gibt hier sehr enge Zusammenhänge. Inwieweit die beobachtbaren Unterschiede tatsächlich ursächlich auf Bildungsunterschiede zurückzuführen sind, ist oft aufgrund fehlender Daten nicht eindeutig zu klären, aber es gibt durchaus kausale Belege.
Worauf legst du deinen Fokus?
Ich habe viel zu den Effekten von Bildung am Arbeitsmarkt geforscht, d.h. zur Verwertbarkeit von beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen, die wesentlich die Chancen im Leben mitbestimmen. Ziel ist es grundsätzlich, einen möglich ganzheitlichen Bildungsbegriff anzuwenden, also einen Begriff, der alle Phasen des Lernens umfasst - von der frühkindlichen Bildung und Erziehung über die Allgemeinbildung und Berufsbildung, die hochschulische Bildung bis hin zur beruflichen und allgemeinen Weiterbildung im späteren Leben. Das bedeutet, dass neben der formalen Bildung des institutionellen Systems der Erstausbildung auch die nicht-formale Weiterbildung und die informellen Bildungsprozesse eine wichtige Rolle spielen.
Was versteht man unter informellen Bildungsprozessen?
Informelles Lernen findet meist außerhalb des formalisierten Bildungsbereichs statt, z.B. im Alltag, im Beruf oder in der Freizeit. Dieses Lernen erfolgt oft beiläufig, ist unstrukturiert und üblicherweise gibt es weder Prüfungen noch Zertifikate. Vielmehr passiert es in den Tätigkeiten selbst – indem man etwa eine interessante Radiosendung hört, mit Freunden oder mit Arbeitskollegen spricht, wo Informationen weitergegeben werden und Diskussionen erfolgen. Im Arbeitsalltag spricht man von so genannten spill-over Effekten, etwa wenn jemand in eine berufliche Weiterbildung geht und dann den KollegInnen über das Erlernte berichtet. Das wären informelle Prozesse, bei denen der Bildungs- oder Kompetenzerwerb quasi en passant passiert. Diese Prozesse sind in der Wirtschaft, aber auch im sozialen Leben sehr wichtig.
Wie lassen sich diese informellen Prozesse messen?
Das ist schwer messbar, weshalb dieser Bereich auch in der empirischen Forschung derzeit noch weniger stark beackert wird, auch wenn wir ihn natürlich immer mitberücksichtigen wollen. Es gibt dazu noch wenige verlässliche Datenquellen. Die europäische Erhebung über Weiterbildung ist hier ein wichtiger Schritt, weil dadurch regelmäßig vergleichbare Daten zu informellen Lernaktivitäten in den EU-Ländern erhoben werden. Hier werden Fragen zum Lernen von Familienmitgliedern, Freunden oder KollegInnen, zum Leseverhalten und zur Rezeption von Wissenssendungen sowie zum E-Learning oder auch zum Besuch von Museen o.ä. gestellt.
An welchen Projekten arbeitest du im Moment?
Ich arbeite gerade gemeinsam mit KollegInnen aus der Forschungsgruppe an Projekten zu sozialem Fortschritt – unser gruppenübergreifendes Thema. In einem Artikel zeichnen wir anhand von PISA-Daten nach, wie sich die Ergebnisse seit der ersten PISA-Studie im Jahre 2000 entwickelt haben. Wir untersuchen dabei, ob sich der Einfluss sozialer Herkunftsmerkmale – etwa Migrationshintergrund und sozioökonomischer Status – auf die Schülerkompetenzen in den vergangenen fast 20 Jahren entwickelt hat und ob es Unterschiede in diesen Entwicklungen zwischen den Ländern gibt. Im Ländervergleich interessiert uns vor allem, wie sich die unterschiedlichen Entwicklungen erklären lassen, also welche institutionellen Merkmale der Länder damit zusammenhängen.
Steht hinter dem Projekt ein Auftraggeber?
Nein, der Artikel entsteht im Rahmen unserer grundfinanzierten akademischen Forschung. Das BMASK hat eine methodisch ähnliche Studie gefördert, bei der wir uns dasselbe für die Qualität der Erwerbsarbeit in Österreich über die Zeitspanne von 2005-2015 angesehen haben. Die Ergebnisse haben wir auf Konferenzen präsentiert, nächstes Jahr gibt es dazu auch noch eine Tagung gemeinsam mit dem Auftraggeber.
Welche Themen bearbeitest du darüber hinaus?
In letzter Zeit habe ich mit stark mit der Arbeitsmarktsituation von Flüchtlingen beschäftigt. Wir haben dazu im September ein OeNB-Projekt abgeschlossen und dazu publiziert, einige Publikationen dazu sind noch in der Pipeline. Was wir uns dabei angesehen haben war etwa der Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und der Geschwindigkeit der Arbeitsaufnahme. Das Interessante dabei ist, dass höhere Bildung nicht unbedingt mit besseren Erwerbschancen im Sinne einer raschen Arbeitsaufnahme zusammenhängt. Anerkannte Flüchtlinge und auch ArbeitsmigrantInnen füllen vor allem jene Jobs aus, die von länger hier Lebenden nicht mehr gerne gemacht werden. Leute mit höherem Bildungsabschluss haben es im Gegenteil oft sehr schwer, Beschäftigung zu finden, was mit der Transferabilität von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen zusammenhängt – also der Anerkennung und Gleichwertigkeit von Abschlüssen und Berufserfahrung.
Im Zusammenhang mit diesem Projekt habt ihr auch ein Tool zur Visualisierung der Daten entworfen.
Genau, wir haben einige interaktive Tools dazu entwickelt. Dafür haben wir Registerdaten verwendet, die alle Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeitsepisoden sowie alle sonstigen registrierten Sozialversicherungsepisoden umfasst. Wir haben diese Daten zurück bis 1997 nach Herkunftsregionen ausgewertet. Über den Zeitverlauft kann man sehen, wie stark einzelne Nationen auf verschiedene Arbeitsmarktstatus verteilt sind. Dabei unterscheiden wir grob 3 Kategorien: erwerbstätig, arbeitssuchend/arbeitslos und erwerbsfern. Mit den Tools kann neben der nationalen Herkunft unter anderem nach Bildungsstand, Familienstand Alter und Geschlecht gefiltert und benutzerdefinierte Auswertungen mit grafischer Darstellung generiert werden.
Welche Bereiche interessieren dich für die Zukunft besonders?
Mich interessiert derzeit besonders die vergleichende Forschung zum Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit in der Bildung und sozialer Ungleichheit im späteren Leben, sei es im Einkommen, Vermögen oder den vielen anderen Bereichen. Auffällig ist etwa, dass es in Ländern mit einem starken Berufsausbildungssystem wie Österreich, Deutschland und der Schweiz, eine sehr frühe äußere Differenzierung im Bildungswesen gibt. Dies geht mit einer relativ hohen sozialen Bildungsungleichheit und einer geringen Chancengleichheit im Bildungssystem einher. Dies führt aber nicht zu einer hohen sozialen Ungleichheit in der Gesellschaft. Es ist umgekehrt eher so, dass auch durch die Lehrlingsausbildung die Arbeitslosigkeit vergleichsweise niedrig ist, und durch soziale Umverteilung ist die Ungleichheit im verfügbaren Einkommen hier fast so niedrig wie in den nordischen Sozialstaaten, und deutlich niedriger als in liberalen und südwesteuropäischen Wohlfahrtsstaaten, die in der Regel eine spätere Differenzierung im Schulsystem haben. Diese Systemvergleiche interessieren mich sehr, auch weil es hier noch relative wenig belastbares Wissen gibt, dafür umso mehr Ideologie.
Zum Schluss zum Persönlichen - wie sieht dein Weg in die Wissenschaft aus?
Ich habe nicht den Weg einer typischen Wissenschaftskarriere hinter mir. Mit meinem Studium habe ich eher lange gebraucht, weil mir noch nicht ganz klar war, in welchen Bereich ich weitergehen möchte. Ich habe während meines Studiums und auch danach insgesamt vier Jahre lang als Journalist beim Standard gearbeitet, zunächst in der Politik-Redaktion, danach in der Wirtschaftsredaktion. Da ist mir klar geworden, dass ich mich mit den gesellschaftlichen Phänomenen doch grundlegender auseinandersetzen möchte und da habe ich dann 2004 das Glück gehabt, hier am IHS anfangen zu können. Das Doktorat habe ich erst später begonnen und 2015 abgeschlossen und bin dadurch auch stärker in Richtung akademische Forschung gegangen. Mein Ziel ist es jetzt, sowohl akademische als auch praxisorientierte Forschung zu betreiben, die wechselseitig anschlussfähig ist.
Passt die Mischung aus akademischer Forschung und Auftragsforschung derzeit für dich?
Nein, nicht wirklich. Solange die Finanzierung durch größere Projekte gesichert ist passt es. Wenn das wegfällt, muss man sich von kleineren Brötchen ernähren und kann weniger wählerisch sein. Das ist dann oft schwer planbar, weil der Erfolg beim Einwerben von Projekten ungewiss ist und sowohl das Einwerben und das Abarbeiten viele Ressourcen binden, gerade wenn die Projekte nicht genau dem eigenen Forschungsschwerpunkt entsprechen. Dazu kommt, dass das Interesse der Auftraggeber meist nicht in der akademischen Forschung gilt. In vielen dieser Auftragsprojekte schlummert aber viel Potential für gute Publikationen, weil der Praxisbezug grundsätzlich für die akademische Forschung relevant ist und oft auch neue und interessante Daten gesammelt werden. Oft fehlen dann aber die Ressourcen für den akademischen Publikationsprozess, der schon sehr aufwändig sein kann. Grundsätzlich haben wir hier am IHS aber ganz gute Arbeitsbedingungen, eine tolle Infrastruktur und viele Möglichkeiten des wissenschaftlichen Austauschs, sowohl national als auch international.
Danke für das Gespräch!