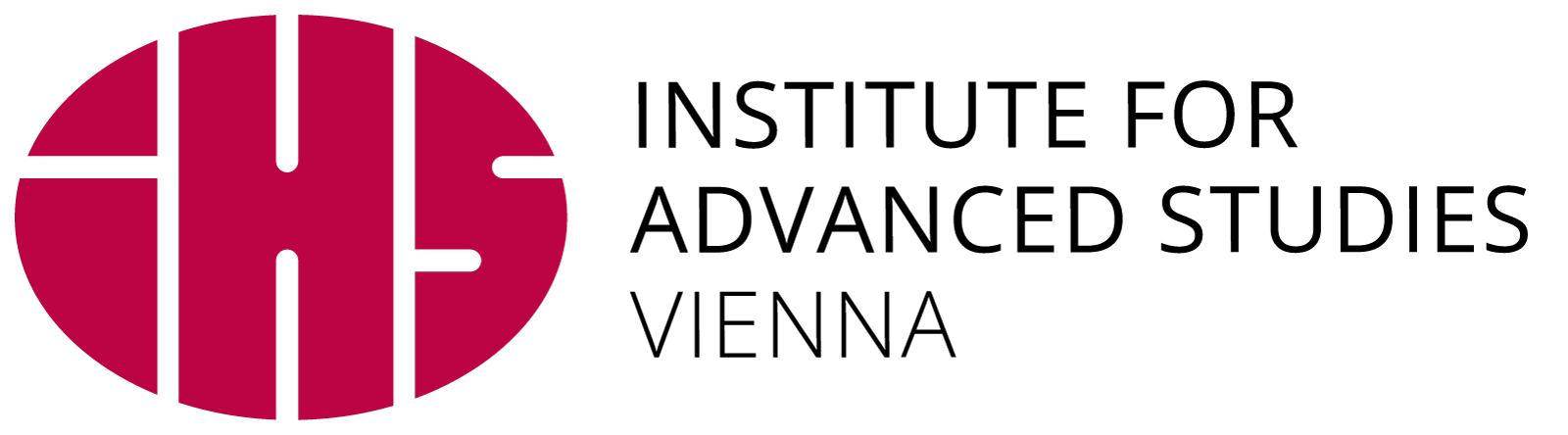Was wir wissen, was wir nicht wissen
Autor: Thomas König
Die COVID-19 Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben Forschungsaktivitäten beflügelt. Das Symposium "Leben mit Corona" möchte Zwischenergebnisse aus Projekten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zur Diskussion stellen und damit auch weitere Forschung initiieren und bündeln helfen. In diesem Beitrag stellt Thomas König einige Reflexionen an.
Die oft zitierte Aussage von Donald Rumsfeld, wonach es „known unknowns“ und „unknown unknowns“ gibt, verdeutlicht wunderbar, den Bereich dessen, was wir nicht wissen, stückweise aufzuarbeiten. Die Wissenschaften sind extrem gut darin, gewusste Nichtwissen einzuzirkeln und durch rigorose Verfahren in Wissen zu münzen. (Die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny hat vor ein paar Jahren ein ganzes Buch dazu geschrieben). Die COVID-19 Pandemie führt uns diese Situation drastisch vor Augen. Im Augenblick wissen wir vor allem, was wir alles nicht wissen (oder, eleganter gesagt: wie wenig wir wissen).
Es gibt hier allerdings zwei Probleme. Das erste ist, dass es in den Wissenschaften selbst erhebliche Anreize gibt, den weiten Raum des Nicht-Wissens mit Abkürzungen zu durchmessen. Wir haben im Augenblick nicht das Problem, dass zu wenig geforscht wird, sondern dass es zu viel ist: es ist eine unübersichtlich, dynamische, und mit vielen Stolpersteinen versehene Situation. Die Schwächen der Wissenschaften stehen ebenso wie ihre Stärken im Brennglas unserer Zeit, und es ist noch überhaupt nicht gesagt, ob das Feuer läuternd wirken wird oder zerstörerisch. (Sicher ist: es gibt viel Potential zur Zerstörung.)
Immerhin gibt es auch Anlass zur Hoffnung: Wie eine Reihe von besonders klugen Wissenschafter*innen kürzlich in Nature geschrieben haben, ist es hoch an der Zeit, die Fehlentwicklungen in der Wissenschaft – spezifisch im Bereich der nunmehr in den Mittelpunkt gerückten statistischen Modellierung – mit jenen Caveats zu versehen, die schon geraume Zeit diskutiert wurden. Und es gibt einen unerschrockenen Wissenschaftsjournalismus, der durch klaren Blick in der Lage ist, Quacksalberei von echten Wissensfortschritten zu benennen. (Als Beispiel empfehle ich den Artikel im NY Times Magazine zum selbststilisierten Vater des nunmehr diskreditierten Hydroxychloroquin.)
Das zweite Problem ist, dass es da auch noch einen ganz anderen Bereich von Nicht-Wissen gibt. die „unknown knowns“, also jenes Wissen, über welches wir nicht wissen (wollen), dass wir es wissen. Wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt geht nicht immer mit gesellschaftlichen Interessen einher, Wissenschaft produziert Wissen, welches unbequem ist. Steve Rayner, dem wir diese Thematisierung des nicht-gewussten Wissens verdanken, hat es auch als „unkomfortables Wissen“ bezeichnet. Es ist evident – so wie schon 2008 –, dass wir eine Menge an solchem unkomfortablen Wissen aufgebaut haben. Eine vernetzte Krise wie die, in der wir uns gerade befinden, kann der Anlass sein, uns diesem Wissen zu stellen.
Das Symposium „Leben mit Corona“ möchte beides ansprechen: Natürlich geht es zunächst einmal darum zu bestimmen, was wir „known unknowns“ vor uns haben, und wie wir dieses Unwissen möglichst effizient aufheben können. Eine Reihe von Hilfsmitteln haben in den letzten Wochen dazu beigetragen, durchs Verfügbarmachen von Ressourcen, durch das Schaffen von Austauschmöglichkeiten, durch das Nutzbarmachen bestehender Infrastruktur, durch das simple Sammeln von Projekten, die sich mit den Auswirkungen der Pandemie sowie der zu ihrer Eindämmung verfügten Einschränkungen beschäftigen.
Es geht aber auch um die „unknown knowns“, also dem, was wir eigentlich schon wissen, aber vielleicht kollektiv (noch) nicht aussprechen. Das sind natürlich zunächst Forschungsergebnisse, die wir ernst nehmen sollten. Aber es ist auch struktureller Art. Wir scheinen nicht zu wissen, welche Daten wir benötigen, um Evidenz zu schaffen, dabei gibt es diese Daten oftmals schon. Wir scheinen nicht zu wissen, was die richtige Teststrategie für COVID-19 ist, dabei gibt es viel methodisches und konzeptionelles Wissen. Wir scheinen nicht zu wissen, wie wir die Forschungspraxis organisieren müssen, um aus den Silos rauszukommen und uns den vielbeschworenen „gesellschaftlichen Herausforderungen“ zu stellen, dabei gibt es auch dafür viele, viele gute Beispiele.
Unbequemes Wissen: auch darum geht es beim Symposium „Leben mit Corona“ am IHS. Dass es ein explizit sozialwissenschaftliches Institut ist, wo der Raum (real und interaktiv) geöffnet wird, um die Beziehung zwischen einem Virus und seinem neuen Wirtsorganismus – dem menschlichen Körper – zu besprechen, ist nur konsequent. Denn dieser Virus tut ja nicht nur etwas zu einem befallenen Körper. Er hat die massivsten Reaktionen und Anstrengungen der letzten Jahrzehnte ausgelöst – Reaktionen und Anstrengungen, die sich nicht nur auf den Wirtskörper erstrecken, sondern auf unser gesamtes Leben, das soziale, das psychische, das schaffende und das müßiggängerische Leben. Was das bedeutet, wollen wir verstehen.